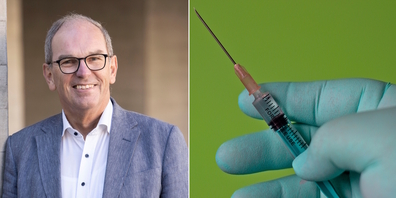Antrag der Regierung im genauen Wortlaut:
«Begründung:
Das Saisonnierstatut wurde ab den 1930er-Jahren im Rahmen des damaligen Bundesgesetzes über Aufenthalt und Niederlassung von Ausländern angewendet. Es zwang Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, nach Ablauf des Arbeitsvertrags – am Ende der «Saison» – wieder aus der Schweiz auszureisen.
Der Aufenthalt wurde zu Beginn auf elfeinhalb und ab dem Jahr 1974 auf neun Monate begrenzt. Damit wurde den grossen Bedürfnissen von saisonal geprägten Branchen wie dem Baugewerbe nach ausländischen Arbeitskräften entsprochen.
Viele Saisonniers aus Italien und Spanien
Herkunftsländer wie Italien und Spanien zeigten sich in der unmittelbaren Nachkriegszeit angesichts der dort herrschenden Arbeitslosigkeit sehr offen gegenüber der Anwerbung von Arbeitnehmenden, auch im Rahmen des Saisonnierstatuts, und unterzeichneten entsprechende Abkommen mit der Schweiz (Endnote 1). Das Saisonnierstatut bot vielen Menschen Beschäftigungsmöglichkeiten, die sie in ihren Herkunftsländern nicht fanden (Endnote 2).
Prekäre Wohnsituationen
Die Bedingungen waren aber auf die Interessen der Wirtschaft ausgerichtet. Es bestand stets die Ungewissheit, ob die Anstellung im folgenden Jahr verlängert würde. Die Saisonniers waren im Übrigen von gewissen Sozialleistungen wie der Arbeitslosenversicherung ausgeschlossen. Faktisch war auch der Abschluss eines normalen Mietvertrags kaum möglich, sodass sich mitunter prekäre Wohnsituationen ergaben.
Illegale Aufenthalte
Die mit dem Saisonnierstatut verbundene Trennung von einem oder beiden Elternteilen hatte für die im Herkunftsland verbleibenden Kinder zweifellos negative Auswirkungen, insbesondere wenn die Wohn- und Familiensituation am Herkunftsort ungünstig war oder das Fehlen des «Familien-Oberhaupts» gerade in traditionellen südeuropäischen Dorfgemeinschaften Nachteile für die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben nach sich zog.
Entsprechend entschieden sich viele Eltern für den illegalen Aufenthalt ihrer Kinder in der Schweiz. Das Verstecktsein in engen Wohnungen und die Nichtteilnahme am Schulunterricht hatten für diese Kinder negative Folgen. Solche Aspekte des Kindswohls wurden lange Zeit auch innerhalb der Migrierenden-Organisationen tabuisiert und damit von der breiten Öffentlichkeit wenig wahrgenommen (Endnote 3), anders als etwa Forderungen zu den Arbeitsbedingungen der Saisonniers.
Verbesserte Aufenthaltsbedingungen ab 1964
Unter dem Druck der Entstehung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft unterzeichnete die Schweiz im Jahr 1964 ein revidiertes Abkommen mit Italien, das die Aufenthaltsbedingungen markant verbesserte. Ab diesem Zeitpunkt war es möglich, unter gewissen Bedingungen eine Statusverbesserung nach mehrmaligen Aufenthalten in der Schweiz zu erhalten.
Aufarbeitung auf Bundesebene
Das Saisonnierstatut war eine gesetzliche Grundlage für die gesamte Schweiz. Die Aufarbeitung dieses Kapitels der Schweizer Migrationsgeschichte müsste folglich auf Bundesebene erfolgen. Mit Blick auf die zuerst nötigen gesamtschweizerischen Bemühungen um Aufarbeitung und den Umstand, dass ein Postulatsbericht für eine kantonale historische Aufarbeitung kein zweckmässiges Format darstellt, beantragt die Regierung, auf das Postulat nicht einzutreten.»
Endnoten
(1) www.sozialgeschichte.ch.
(2) In den 1960er-Jahren betrug gesamtschweizerisch der Anteil Saisonniers an den beruflich tätigen Ausländerinnen und Ausländern mit rund 155'000 Personen rund 20 Prozent. Im Kanton St.Gallen hatten im Jahr 1974 noch rund 7'300 Personen eine Saisonnier-Bewilligung; das entsprach ungefähr 12 Prozent der ausländischen Wohnbevölkerung.
(3) M. Michelet, «Ce qui est sûr, c'est qu'on n'était pas censés être là…»: reconstituer l'histoire d'«enfants du
placard» à partir de silences (1964–1986), in: Traverse: Zeitschrift für Geschichte, 2022/3, S. 107 u.a.